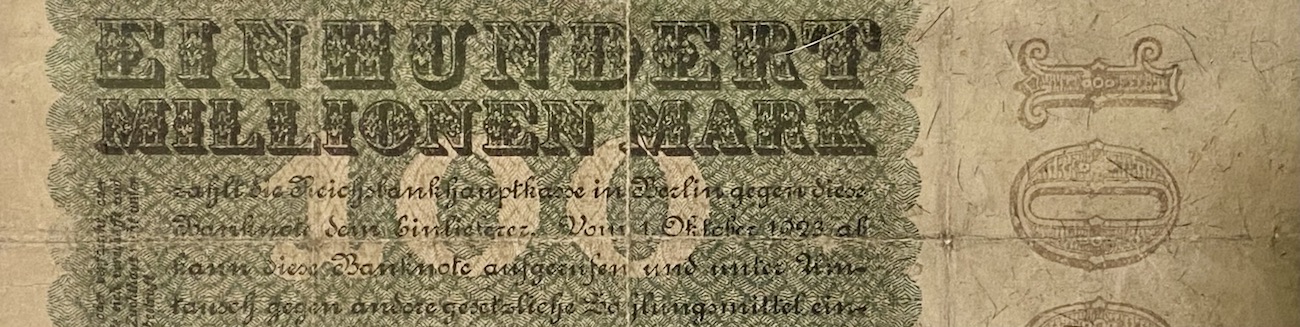Wie wäre das, nur ein paar Tage pro Jahr der Erwerbsarbeit nachzugehen? Wie verteilen Unternehmen ihre Gehälter? Über die Grenzen von Geld und Glück.
Fat Cat Day
Vergangenen Freitag, am 9. Jännen 2026, war Fat Cat Day, eine Art Equal Pay Day für Menschen, die in unserem Land Spitzengehälter erhalten (ob sie’s verdienen, entzieht sich meiner Kenntnis). Soll heißen, dass Topverdiener*innen in den ersten paar Arbeitstagen des Jahres die gleiche Summe wie das österreichische Medianeinkommen erwirtschaftet haben. Median, das heißt kurzgefasst: die Hälfte aller Einkommen ist drüber, die andere Hälfte drunter. Durchschnitt ist was anderes.
58 Arbeitsstunden sind es, die Manager*innen der größten ATX-börsennotierten Unternehmen durchschnittlich arbeiten, um ein mittleres Jahres-Nettoeinkommen von € 42.012.- aufzuwiegen. Dabei beträgt die sogenannte Manager to Worker Pay Ratio, also das Verhältnis von Spitzen- zu Normalgehalt, etwa 66:1. Soll heißen, eine Vorstandsvorsitzende findet auf dem Lohnzettel eine etwa 66mal so große Summe wie ein einfacher Angestellter. Wobei die Sache so nicht ganz stimmt. Weil eben unter den Top 20 der einkommensstärksten ATX-CEOs gerade einmal eine Frau zu finden ist, auf Platz 19. Naja.
Der Wert von Arbeit
Jetzt könnte ich natürlich meine Phantasie anstrengen und mir ein Szenario vorstellen, in dem Mitarbeitende des selben Unternehmens Arbeitsleistungen erbringen, die so extrem unterschiedlich wertvoll sind. Aber da komm ich nicht hin. Liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich könnte um das gleiche Geld (meines in dem Fall) eine Neiddebatte vom Zaun brechen. Worauf ich keine Lust habe. Die Welt ist an Neiddebatten auch ohne mich schon reich genug, da braucht’s nicht noch eins drauf.
Erlaubt sei vielleicht ein Blick auf das, was es mit einem Unternehmen auf Dauer macht, wenn weit überdimensional viel Gewinn in die Taschen einer winzigen Handvoll an Personen fließt. Und wie oft es dann in den Wirtschaftsnachrichten heißt, dass aufgrund massiver Überschuldung wieder eine Großinsolvenz auf dem Tisch liegt. Es sei einfach kein Geld mehr da, man müsse so und so viele Angestellte der Betreuung durch das Arbeitsmarktservice überantworten. Nein. Wenn wir etwas gelernt haben von der Finanzkrise von 2008, dann Folgendes: Das Geld ist nicht weg. Es ist nur woanders.
Cui bono?
Die Frage, die ich mir stelle, ist – dem Grundakkord dieses Blogs folgend – die Frage nach dem Nutzen. Dem Nutzen nämlich von Gehältern, die sich fernab aller argumentierbarer Notwendigkeit bewegen. Dazu ein paar suffizienzgetriebene Gedanken. Weil sich ein Mensch zugleich immer nur in einem einzigen Raum aufhalten kann, erreicht auch die großzügigste Wohnsituation relativ schnell ihre Unsinnsgrenze. Ich weiß es aus eigener Erfahrung mit zwei Häusern, die jeweils drei bis vier Zimmer hatten, in denen ich niemals war. Auch was Ernährung und Kleidung betrifft, sind die Grenzen des Notwendigen unter Einberechnung eines Luxusaufschlags bald erreicht. Fahrzeuge, Schulen für die Kinder, Reisen – all das kostet Geld, stimmt. Und die Spanne zwischen Sparta und Sybaris ist weit.
Nein, ich will dir kein Armutsgelübde einreden. Wozu auch? Ich frage mich nur, wo und wie wir das Maß finden, das uns ein zufriedenes Leben führen lässt. Ein Leben, in dem wir selbst die Linie zwischen dem Genug und dem Zuviel ziehen. Ein Leben, in dem wir, ohnehin gesättigt, einen Schritt zurücktreten, damit auch andere ihr Stück vom Kuchen bekommen. Ein glückliches Leben.
Viel hilft viel?
Geld macht glücklich. Ja. Also in dem Sinn, dass wir mit einem guten Einkommen glücklicher sind als mit einem Gehalt, das uns ständig am materiellen Abgrund entlang taumeln lässt. So weit, so nachvollziehbar. Aber. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann (der uns übrigens auch den Unterscheid zwischen schnellem und langsamem Denken beigebracht hat), wollte es genauer wissen. Es. Also die Summe, bis zu der Geld einen Motivationsfaktor darstellt. In einer Studie aus dem Jahr 2010 kam er auf die magische Zahl von etwa 75.000.- USD (ca. € 64.000.-).
Dieses Jahres-Nettoeinkommen war die Grenze, über der mehr Geld nicht mehr Glück bedeutet. Sich glücklicher zu fühlen ist oberhalb dieser Summe in erster Linie eine Folge von etwas, das wir kostenlos geben und erhalten können: Liebe. Das gilt nicht nur für mittelgewichtige, sondern auch für sehr fette Katzen. Als hauptberuflichen Romantiker erfreut mich das Ergebnis dieser Studie über alle Maßen.

Auf der Suche
Stichwort Gerechtes Einkommen: Bis Juni 2026 haben Unternehmen Zeit, die vor drei Jahren beschlossene Lohntransparenz-Richtlinie der EU umzusetzen. Die zielt zwar in erster Linie auf die oft grobe Schieflage zwischen Gehältern von Männern und Frauen ab, soll aber durch eine Reihe von Maßnahmen für mehr Lohntransparenz und Einsicht in Gehaltsberechnungen sorgen. Was uns allen nützen sollte. Das allein wird fette Katzen allerdings nicht auf Schonkost setzen.
Wenn es dir wichtig ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, das mit der Ressource Gehalt fair und gleichzeitig suffizient umgeht, mach dich kundig! Klemm dich hinter die Tasten und stell dem Netz die Frage, welche Unternehmen für Lohngerechtigkeit stehen (der passende Neologismus ist Equal Pay). Ich werde hier keine Unternehmen hervorheben, das ist nicht meine Aufgabe. Aber wenn du willst, kannst du ja einige der Treffer, die du bekommst, mit Unternehmens-Bewertungsplattformen wie kununu abgleichen. Mit dem, was du dort herausfinden kannst, rückst du ein Feld vor zu ganz konkreten Arbeitgebern, denen Fairness und Suffizienz nicht nur bedeutet, dass der CEO und du den gleichen Obstkorb auf den Tisch bekommen. Weil eben auch eine gerechte Bewertung unserer Arbeit ein bisschen glücklich macht.
Hier geht’s zu Infos zu Stefan Peters