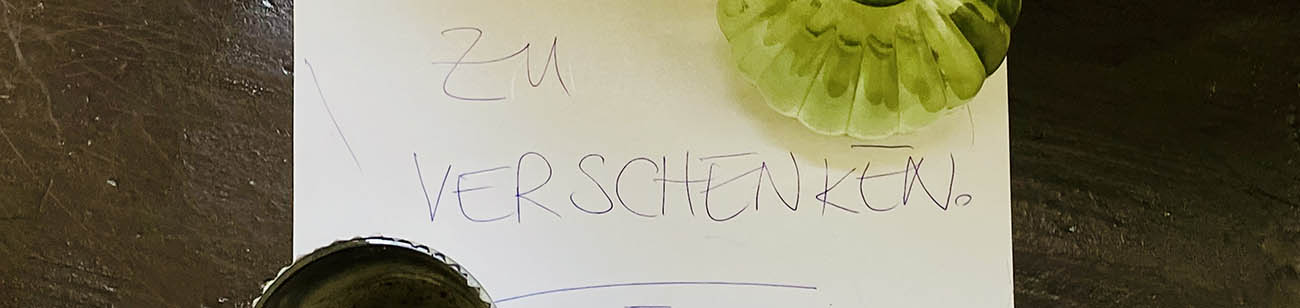Was brauchma was, von demma nix ham? Wozu Willschenken? Ist ein Geschenk eine familiäre Verwicklung wert? Vom geldlosen Geben und Nehmen.
Lackierpistole zu verschenken und eine Parteizeitung
Gestern fand ich im Keller eine Lackierpistole, ein Ding, mit dem man, getrieben von Druckluft, Farbe auf Dinge sprühen kann. Vor Jahrzehnten hatte ich im Zusammenhang mit einer Oldtimerrestaurierung einen Haufen Geld dafür hingeblättert, seitdem wanderte die Lackierpistole mit mir ungenutzt durch diverse Wohnsitze. Mir fiel ein Freund ein, ein begnadeter Bastler, der mir seinerzeit massiv geholfen hatte, in unseren Campingbus ein Bettgestell zu schweißen. Einen Anruf und zwei Stunden später holte er das Ding hocherfreut ab, er hatte ohnehin demnächst ein Motorrad zu lackieren.
Schenken ist eine relativ einfache Technik, die dir hilft, dein Leben schlagartig zu erleichtern. Die eingangs gestellte Frage „Was brauchma was, von demma nix ham?“ stammt, glaube ich mich zu erinnern, vom Falter-Gründer, Medienkritiker und Chefintellektuellen Armin Thurnher. Er formulierte den Satz im Zusammenhang mit der Einstellung der vormaligen SPÖ-Parteizeitung AZ im Jahr 1991, als es so aussah, dass Parteimedien ihren jeweiligen Parteien mehr Schaden als Nutzen bereiteten (heute sieht das anders aus, da treiben Parteien erfolgreich noch die krudeste Verschwörungssau an seriös produzierten Medien vorbei durchs Dorf). Einlassung zur Einlassung: auch die AZ wurde seinerzeit erst von der Partei an einen Werbeagenturchef quasi verschenkt, ein Geschenk, das, wäre es ein Erbe, niemand angenommen hätte, der so recht bei Verstand war.
Schenken im Netz und am Fensterbrett
Auf der Plattform Willhaben, von der schon früher die Rede Rede war, gibt es auch die Möglichkeit, über den Button Willschenken Dinge kostenlos abzugeben. Nicht, dass ich verstehen muss, welchen Wert und Gebrauch andere Menschen Dingen beimessen, die mir im Weg sind. Doch was ich verstehe, sehr gut verstehen kann, das ist die beiderseitige Freude, wenn etwas seinen Besitzer wechselt, ohne dass dabei Geld fließt. Dieses Unterwandern des Marktradars ist selbstverständlich eine zutiefst subversive Praxis. Vielleicht ist es gerade das, was mir die Schenkerei so lieb macht.
Auf einem Fensterbrett bei mir im Hausflur, gegenüber der Briefkästen, legen Nachbar_innen immer wieder Dinge ab, die sie nicht mehr brauchen: Bücher, Geschirr, Prozentpickerln (hatten wir auch schon hier im Blog). Die ungeschriebene Regel lautet, dass, wenn’s in drei Tagen nicht weg ist, dann kommt’s weg. Also in den jeweiligen Mist.
Das einzig Blöde in der Richtung passierte uns vor einigen Tagen. Da brachten wir den grundsolid-sauschweren Sonnenschirmständer einer Nachbarin, die ihn uns umzugsbedingt geschenkt hatte, in den Garten meiner Frau. Zurück zuhause, stellte sich heraus, dass der geschenkte Ständer immer noch da war. Wir hatten versehentlich den einer anderen Nachbarin genommen.

Richtig im Garten sind allerdings die vier Solarpaneele, die uns die Schwester meiner Frau, auch umzugsbedingt, geschenkt hat. Ich freue mich darauf, sie zu verbasteln und Strom zu ernten.
Wer Requisiten frisst, frisst auch kleine Kinder
Etwas herschenken, Dinge ohne monetären Gegenwert zu übergeben, ist eine Art Sekundärtugend der Suffizienz (die Primärtugend wäre nach dieser Logik, sich erst gar nicht mit etwas zu belasten). Ballast abzuwerfen, ohne gleichzeitig neuen Ballast aufzunehmen macht mich leichter, klar doch. Okay, ich war etliche Jahrzehnte lang einer, der alles aufgehoben hat, das kurios, selten, potenziell wertvoll oder zumindest vielleicht eines Tages verwendbar gewesen sein könnte. In dem Zusammenhang kommt mir ein Stehsatz meines Vaters in den Sinn: „Es gibt nichts, was nicht Requisite sein könnte“ (er dachte dabei zugegebenermaßen in erster Linie an seine Steuererklärung). Jedenfalls besaß ich irgendwann ein paar Kubikmeter an potenziellen Requisiten für was auch immer. Die lagerten verteilt auf einige Keller und Dachböden. Die Dachböden sind längst ausgeräumt, die Dinge verschenkt, verkauft, entsorgt. Ein Keller ist geblieben und ein paar kleine Schachteln mit vermischtem Sammelkram, an dem ich – noch – sentimental hänge. Kann gut sein, dass ich die Dinge beizeiten aufs Fensterbrett stelle. Sie sozusagen auf die Reise schicke. Was mir mein Vater zum Thema noch mitgegeben hat, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen: „Wer Requisiten frisst, frisst auch kleine Kinder.“ Das erhellt möglicherweise meine ehemalige Neigung, die Dinge eher aufzuheben als zu verbrauchen.
Nix für emotionale Anfänger
Das Schwierige am Schenken ist ja nicht das Geben und Nehmen. Das kriegen wir schon hin, sobald wir uns vom Trieb des Ansammelns und Aufhäufens emanzipiert haben (Sigmund Freud hat das Nicht-Loslassen-Können mit einer Störung aus der analen Phase heraus erklärt). Wirklich schwierig ist aus meiner Sicht die gegenseitige systemische Abhängigkeit, die daraus entsteht, die tatsächliche oder wenigstens gefühlte Verpflichtung, der sich zu entziehen nix für emotionale Anfänger ist. Wer Familie hat, weiß, was ich meine.
Aber wie auch immer: Im Grunde ist die Verschenkerei wie die Sache mit den kommunizierenden Gefäßen: am Ende kommt immer eine Art Ausgleich dabei heraus. Damit meine ich jetzt kein Vergelt’s Gott im Jenseits und auch keine karmische Punktekarte, wo dir eine nebulöse Entität was auf- oder abbucht. Kriegst du ein Danke oder ein Lächeln oder sogar ein Gegengeschenk, nimm’s an! Kriegst du nichts zurück, bekommst du jedenfalls ein Stück Freiheit, und das macht dein Leben schon wieder ein Stück leichter.
Hier geht’s zu Infos zu Stefan Peters